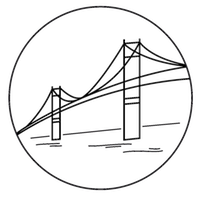37. Passauer Arbeitsrechtssymposion am 20. und 21. Juni 2024:
Mobile Working
Arbeit im Homeoffice gehört heute für viele zur Normalität. Was in der Ausnahmezeit der Corona-Pandemie weitgehend ungeregelt begann, wirft als Dauerzustand schwierige Rechtsfragen auf, die oft erst ansatzweise geklärt sind. Ob sich das Arbeitsrecht, das eigentlich für die Arbeit im Betrieb konzipiert war, ohne weiteres an das „New Normal“ anpassen lässt, wollen wir mit Experten aus Theorie und Praxis diskutieren:
- Müssen Beschäftigte im Homeoffice ständig erreichbar sein?
- Welche Grenzen ziehen BetrVG und DSGVO der Kontrolle von Mobile Working?
- Lassen sich arbeitsschutzrechtliche Arbeitgeberpflichten im Homeoffice haftungsbefreiend auf den Arbeitnehmer delegieren?
- Ist jeder Unfall im Homeoffice ein versicherter Arbeitsunfall?
- Welche Risiken drohen, wenn das Homeoffice im Ausland liegt, und wie vermeidet man sie?
- Was muss bei Mobile Working geregelt werden und wie kommt der Arbeitgeber von solchen Regelungen wieder los?
- Welche Fehler bei digitalen Betriebsratssitzungen machen Beschlüsse unwirksam?
- Die sieben Todsünden des Mobile Working – und wie man ihnen beikommt.

Die Anmeldung zum 37. Passauer Arbeitsrechtssymposion ist sowohl postalisch als auch über das in Kürze zur Verfügung stehende Online-Anmeldeformular möglich, eine ausführliche Übersicht über die Themen der diesjährigen Referenten finden Sie unter Programm. Alle Informationen rund um das diesjährige Symposion finden Sie im Flyer.
Das Passauer Arbeitsrechtssymposion wendet sich an Arbeitsrechtsexperten in Unternehmen und Verbänden, an Rechtsanwälte, Wissenschaftler und Richter. Den Tagungsbericht zum vorangegangenen 36. Passauer Arbeitsrechtssymposion 2023 zum Thema »Deutsches und Europäisches Arbeitsrecht im Dialog« finden Sie im Archiv.
Ziel der Veranstaltung ist es, für die Praxis bedeutsame Arbeitsrechtsfragen wissenschaftlich aufzubereiten, der Praxis Hilfestellung bei der täglichen Arbeit und der Wissenschaft Anregungen zu geben und beide miteinander ins Gespräch zu bringen.
Informationen zur Schriftenreihe der Stiftung Theorie und Praxis des Arbeitsrechts (Wolfgang-Hromadka-Stiftung) finden Sie auf der Seite des Nomos-Verlags.